Bryan Caplan zum Kartellrecht

Ich habe angefangen, Bryan Caplans hervorragendes neues Buch „ Pro-Market and Pro-Business: Essays on Laissez-faire“ zu lesen und habe die ersten zwölf (kurzen) Kapitel durchgelesen. Ich hatte gehofft, viel Stoff zum Schreiben zu finden, aber leider stimme ich Bryans Argumenten fast vollständig zu. Ein Kapitel zum Kartellrecht fand ich allerdings etwas unbefriedigend. Obwohl ich selbst in diesem Fall wahrscheinlich den politischen Implikationen seiner Argumentation zustimme:
Seit 2007 hat Bill Gates 28 Milliarden Dollar gespendet, 48 % seines Nettovermögens. Frugal Dad schätzt, dass er damit fast sechs Millionen Leben gerettet hat . Ich habe seine Quellen nicht überprüft, aber die Schätzung ist plausibel.
In den 90er Jahren erlebte Bill Gates weitaus weniger positive Schlagzeilen – und wurde juristisch verfolgt. Die US-Regierung verklagte Microsoft wegen Kartellrechtsverstößen . Im Jahr 2000 schätzte Alex Tabarrok, dass der Kartellrechtsfall die Microsoft-Aktionäre 140 Milliarden Dollar gekostet hatte . Zwar einigte sich Microsoft letztlich auf einen vergleichsweise günstigen Vergleich. Doch Gates wäre wahrscheinlich um Milliarden reicher, wenn es keine Kartellgesetze gäbe.
Wenn Gates' Philanthropie so wirksam ist, wie die meisten Leute denken, hat das eine schockierende Konsequenz: Das Kartellverfahren gegen Microsoft forderte eine enorme Opferzahl. Gates rettet für jede ausgegebenen 5.000 Dollar etwa ein Leben. Hätte ihn das Verfahren 5 Milliarden Dollar gekostet und er 48 % gespendet, hätte das Kartellrecht 480.000 Menschenleben gekostet. Hätte ihn das Verfahren 5 Milliarden Dollar gekostet und er jeden Cent gespendet, hätte das Kartellrecht eine Million Menschenleben gekostet. Stellen Sie sich vor, wie viele Menschen heute sterben würden, wenn es der Regierung gelänge, Microsoft in die Knie und Gates in den Bankrott zu zwingen. Es ist unvorstellbar.
Ich habe in Gesprächen mit Leuten ein ähnliches Argument über Bill Gates vorgebracht, aber ich denke, das geht ein bisschen zu weit:
Man könnte einwenden: „Gemäß den Maßstäben tötet Gates selbst Millionen, indem er nicht mehr gibt.“ Für Konsequentialisten ist das völlig richtig; in den Augen von Jeremy Bentham und Peter Singer sind wir alle Mörder. Bleiben wir jedoch bei der gängigen Unterscheidung zwischen „Töten“ und „Sterbenlassen“, ist Gates unschuldig, die Regierung aber schuldig.
Ich halte das alles nicht für eine vernünftige Interpretation. Ich bin Konsequentialist und glaube nicht, dass der Verzicht auf Wohltätigkeit Mord ist. Ebenso wenig glaube ich, dass eine „vernünftige Unterscheidung“ die US-Regierung in diesem Fall des Tötens schuldig sprechen würde.
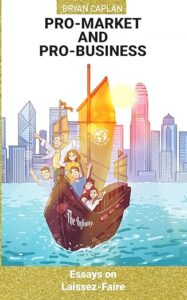
Kartellrecht beinhaltet sowohl Effizienz- als auch Gerechtigkeitsfragen. Ich bin skeptisch, ob das Kartellverfahren der US-Regierung gegen Microsoft die Wirtschaft effizienter gemacht hat, und ich vermute, Bryan ist ebenfalls skeptisch. Daher würden unsere politischen Ansichten wahrscheinlich in etwa gleich ausfallen. Bryans Beitrag konzentrierte sich jedoch implizit auf die Auswirkungen der Umverteilung , nicht auf die Effizienz , daher möchte ich hierauf eingehen.
Die Logik dieses Kapitels legt nahe, dass Einkommensumverteilung von den Reichen zur Mittelschicht aus utilitaristischen Gründen schlecht ist, da die Reichen viel eher bereit sind, den Ärmsten der Welt zu helfen. Im Fall von Bill Gates trifft das wahrscheinlich zu. Öffentliche Politik sollte jedoch nicht darauf basieren, wie sie sich auf eine einzelne Person auswirken würde; vielmehr müssen wir die Gesamtwirkung jeder Umverteilungspolitik berücksichtigen. Viele Reiche geben ihr Vermögen für Konsum aus und/oder spenden für wohltätige Zwecke wie finanzstarke Universitäten und woke-orientierte Stiftungen.
Kartellrecht ist ein seltsames Beispiel für solche Fragen. Vielmehr ist es sinnvoller, über die optimale Ausgestaltung von Steuer- und Transferprogrammen nachzudenken, wenn man konsequentialistische Argumente anführt, die auf der Annahme basieren, dass Milliardentransfers an Milliardäre den Ärmsten der Welt helfen würden.
Wäre Bill Gates typisch für ihn, wäre es vielleicht optimal, die Steuern für die amerikanische Mittel- und Oberschicht deutlich zu erhöhen und die Steuern für Milliardäre deutlich zu senken. Noch besser wäre in diesem Fall jedoch eine stark progressive Verbrauchssteuer, deren Einnahmen genau in die Entwicklungshilfeprogramme fließen würden, die die DOGE-Anhänger kürzlich gekürzt haben. Man könnte argumentieren, dass diese Umleitung von Geldern in arme Länder politisch unrealistisch ist, da die meisten Wähler glauben, Wohltätigkeit beginne im eigenen Land. Das stimmt zwar, aber es stimmt auch, dass eine Politik deutlich höherer Steuern für die Mittelschicht nicht besonders populär ist.
Was ist also politisch machbar? Eine Antwort lautet, dass die einzige politisch machbare Steuerpolitik derzeit das ist, was auch immer der Kongress dieses Jahr verabschiedet. Ich halte diese Argumentation für übertrieben defätistisch. Eine stark progressive Verbrauchssteuer für Reiche ist im Kongress nicht leicht zu verkaufen, aber sie ist sicherlich weniger unpopulär als die Einführung einer stark regressiven Einkommenssteuer. Ein stark progressives Verbrauchssteuersystem hält Bill Gates keineswegs davon ab, den Ärmsten der Welt zu helfen. Dennoch erfordert dieser Plan nicht, dass wir uns bei Überlegungen zur optimalen Steuer- und Kartellpolitik um das Wohl der Milliardäre sorgen.
Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob Bryan diese politischen Ansichten teilt. Aber in einer Welt, in der viele Menschen tatsächlich konsequentialistisch denken, halte ich es für unnötig provokant, zu behaupten, die Welt wäre besser dran, wenn unsere reichsten Milliardäre noch reicher wären. Mit einer stark progressiven Verbrauchssteuer lässt sich dasselbe erreichen, ohne potenzielle Anhänger freier Märkte und Großkonzerne abzuschrecken.
Was das Kartellrecht betrifft, würde ich es vorziehen, wenn es sich ausschließlich auf Effizienzfragen konzentriert (was vor allem bedeutet, staatliche Markteintrittsbarrieren anzugreifen) und Fragen der Umverteilung unserem Steuer- und Transfersystem überlässt. Wenn der Fall Microsoft kontraproduktiv war, dann deshalb, weil er unsere Wirtschaft weniger effizient machte.
econlib




